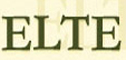Farkas Gábor Farkas: A Nagyszombat Egyetemi Könyvtár az alapításakor, 1635 - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 23. (Budapest, 2001)
Der Urbestand der Universitätsbibliothek
chereien in Znióváralja und Vágsellye günstige Basis für das Verfassen der Confutatio Alcorani bildeten. In der 1586 im Jahre der Errichtung der Residenz veröffentlichten Ratio studiorum wurde festgelegt, dass die Jesuiten ohne Bücher wie Soldaten ohne Waffen seien. In diesem Sinne wurde auch der Bestand der Bücherei vermehrt. In den Jesuitenschulen wurde immer darauf Acht gelegt, dass parallel mit der Schulorganisation auch die Bibliotheksfrage gesichert werde. Zu diesem Zwecke wurden entweder neue Bibliotheken gegründet oder die älteren Bestände durch Kauf in Ausland oder durch Spenden vermehrt. Die Lage der Universitätsbibliothek in Nagyszombat war seltsam: Die Bibliothek selbst ist nämlich älter, als die Universität. Die Benützung einer zweckmäßig vermehrten Bibliothek wurde aber gleichzeitig streng geregelt. Das Lesen der verbotenen Bücher war z.B. folgendermaßen geordnet: Die Bücher sollten in eine geheime Lesekammer separiert werden, die allein dem Rektor zugänglich war. Viele Werke gelangten in diese finstere Kammer, so z.B. Werke von Catull, Tibull, Properz, Ovid, Plautus, Terenz und Martialis. Es wurde gleichsam verboten, nur aus Neugier solche Bücher zu lesen, mit denen man nicht zu tun habe. Hier muss noch unbedingt die von Possevino für die Benützung der Bücherei des Klausenburger Kollegiums verfasste Ordnung erwähnt werden. Ohne Erlaubnis seines Lehrers dürfe niemand Bücher bei sich halten. Diejenigen, die auch verbotene Bücher besaßen, mussten sie dringend dem Rektor übergeben und durften erst mit dessen Erlaubnis lesen. Es scheint ebenfalls wichtig zu sein, auch die Frequenz und Form der Benutzung zu analysieren. Es ist nämlich aus der Sicht unserer Untersuchung gar nicht egal, ob der ehemalige Besitzer das Werk tatsächlich las oder nur durchblätterte. Nach den bisherigen Forschungserfahrungen kann festgestellt werden, dass die inhaltlichen Bemerkungen sowie weitere Vermerke am Rande relativ häufig sind. Hauptsächlich bei solchen Besitzern, deren Namen uns auch bekannt waren, fanden wir Eintragungen über die Familien- oder Landesgeschichte. Die Bücher waren vorwiegend im Oktav- und Quadratformat. Die Besitzer erwarben ihre Grammatikkenntnisse aus Lehrbüchern der klassischen Autoren. Bei den Handbüchern spielten auch die praktischen Überlegungen relativ große Rolle. Die Zensurmaßnahmen der Jesuiten sind auch am Beispiel einiger Bände zu sehen: Die Namen der protestantischen Verfasser sowie der Mitarbeiter (z.B. der Name von Philipp Melanchthon) wurden gestrichen oder abgelöst. Die frivolen Zeilen der Epigrammen von Janus Pannonius wurden stark gestrichen, die Stiche in dem Werk von Hieroglyphica des Johannes Valerianus ebenfalls retuschiert. Aus der Zeit der Residenz kennen wir schon Bucherwerbungen. In dem Bestand der Schulbücher ist der katholische Einfluss des Tridentinums noch kaum wahrnehmbar. Entsprechend dem auf den klassischen Autoren basierenXLV