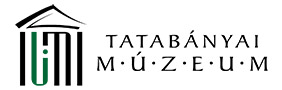Kisné Cseh Julianna – Kiss Vendel (szerk.): Tatabányai Múzeum 2011 - Tatabányai Múzeum Évkönyve 2. (Tatabánya, 2012)
Groma Kata: Csónakfibulát tartalmazó sír Tatabánya–Dózsakertből
Csónakfibulát tartalmazó sír Tatabánya-Dózsakertből 43 Im östlichen Teil des Grabes wurden zwei kegelstumpfförmige Schalen, und eine halbkugelförmige, innerlich mit Grafit bemalte Schüssel mit Omphalos platziert. Obwohl sie auf der Grabzeichnung nicht zu sehen ist, gehört - nach dem Inventar - auch eine hohle Schüssel mit eingezogenem Rande zum Grab. Die einzige Metall-Beilage des Grabes - eine bronzene Kahnfibel - ist nördlich von der Schalengruppe zu finden. Sie ist nicht verziert, und selbst ihr Fuss hat keinen Knopf am Ende. In der Knochenfunde ist am besten der Schenkelknochen erhalten. Daneben ist auch wenig Holzkohle und kalzinierte Knöchern zu sehen. Die Keramikbeigaben haben die besten Parallelen in den Flachgräberfeldern von der Nordost- pannonischen Hallstattgruppe, wie Nagydém-Kö- zéprépáspuszta, Halimba-Cseres und Lábatlan. Wir können der ersten Urne ähnliche Gefäße in der österreichischen Sulmtal-nekropole nachweisen. Nach der C. Dobiats Typologie kann das Kegel hal sgefäss in die 2. Gruppe eingereiht werden. Zur 2. Urne finden wir Parallelen aus der südmährischen und südwestslowakischen Hallstattzeit. Da halbkugelförmige Schalen, bzw. Schüsseln mit eingezogenem Rand für die ungarischen, slowakischen, mährischen und österreichischen Keramikgrabinventare typisch sind, haben kegelstumpfförmige Schalen weniger Parallelen. Die Form der Kahnfibel ist typisch norditalienisch, ist aber auch im Gebiet der Osthallstadt-Kultur verbreitet. Biba Terzan hat die Fibeln in fünf verschiedene Gruppen geteilt. Drei Gruppen dieser Typologie wurden auch in Transdanubien gefunden. Interessant ist, dass dieser Typ von Fibeln (in die auch diese Kahnfibel gehört) auch östlich der Donau (Csanytelek) und auch in Rumänien (Banat) vorkommt. Der beste Ausgangspunkt zur Datierung des 9. Grabes von Tatabánya-Dózsakert ist die Fibel. Wir können sie in den Übergang HaC-HaD stellen. Dies stimmt mit den allgemeinen Datierungen der Flachgräberfelder im Nordost-Transdanubien überein, und bedeutet ungefähr das Ende des 7. Jahrhunderts und den Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr. 5i A német összefoglalás elkészítésében nyújtott segítséget Czajlik Nórának köszönjük. Irodalom Bader 1983 Bader, T.: Die Fibeln in Rumänien. Prähistorische Bronzefunde 14.6. München 1983. Dobi at 1980 Dobiat, C.: Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik. Beiträge zur steinerischen Vor- und Frühgeschichte und Münzkunde. Graz 1980. Durkovic 2009 Durkovic Eva: Kora vaskori temető Fertőrákos- Kőhidai dűlőn. ComArchHung 2009 (2009) 51-83. DuSek 1957 Dusek, M.: Die Hallstattkultur der Chotín-Gruppe in der Slowakei (Zusammenfassung). SlovArch V-l (1957) 73-173. Fekete 1985 Fekete Mária: Adatok a koravaskori ötvösök és kereskedők tevékenységéhez. - Beiträg zur Tätigkeit der früheisenzeitlichen Toreuten und Händler. ArchÉrt 112. (1985)68-91. Galántha 1984 Galántha Márta: The schitian age cemetery at Csanytelek-Újhalastó. IN: Jerem Erzsébet (szerk.): Hallstatt kolloquium Veszprém 1984. Anteus 3. Jerem 1971 Jerem Erzsébet: Késővaskori sírleletek Beremendről (Baranya megye). JPMÉ 16 (1971) 69-91. Kemenczei 1977 Kemenczei Tibor: Hallstattzeitliche Funde aus der Donaukniegegend. FolArch 28 (1977) 67-90. Kemenczei 2009 Kemenczei Tibor: Studien zu den Denkmälern sky- tisch geprägter Alföld Gruppe. Inventaria Prae- historica Hungáriáé 12. Bp. 2009. Kisné 1990 Kisné Cseh Julianna: Egy település élete. Tatabánya 1990. Kisné-Vékony 2002 Kisné Cseh Julianna-Vékony Gábor: Régészeti kutatások Tatabánya-Dózsakertben (1993-1999). IN: